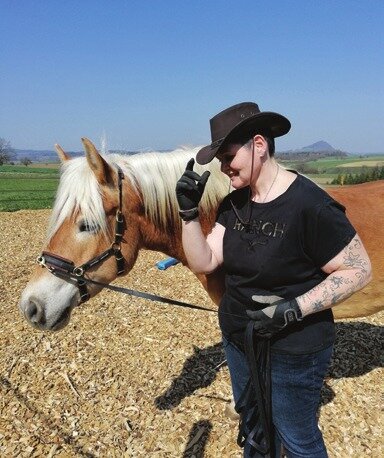Anweidezeit
EINE HERAUSFORDERUNG FÜR DAS VERDAUUNGSSYSTEM UNSERER PFERDE
Das Verdauungssystem von Pferden ist überaus empfindlich. Auf plötzliche Änderungen im Futterplan sind sie nicht eingestellt, denn das kommt in der Natur auch nicht vor. Durch die Fütterung von Raufutter wie Heu und Stroh vermehren sich die Zellulose zersetzenden Bakterien im Blinddarm und Dickdarm. Eine plötzliche Umstellung im Frühjahr auf eiweiß- und kohlenhydratreiches Weidegras verändert massiv die Lebensbedingungen der Bakterien.
Die Darmflora braucht Zeit
Die Darmflora des Pferdes benötigt in der Regel 2 – 4 Wochen, um sich an neue Bedingungen anzupassen. Pferde mit Stoffwechselproblemen oder Tiere, die bereits Hufrehe hatten, sollten daher länger und langsamer angeweidet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass Pferden nur selten kräuterreiche Weideflächen zur Verfügung stehen, die dem Pferdedarm schützende Gerb- und Bitterstoffe liefern. Junges Frühjahrsgras enthält hohe Konzentrationen an Kohlenhydraten, die sich aus langkettigen Zuckermolekülen zusammensetzen, den (gefürchteten) Fruktanen. Diese dienen der Pflanze als Speicherform, insbesondere in den Morgenstunden nach kalten Nächten, wenn das Wachstum der Pflanze eingeschränkt ist. Kohlenhydrate müssen enzymatisch im Dünndarm verdaut werden, denn nur hier kommen die notwendigen Enzyme vor. Blinddarm und Dickdarm dagegen beherbergen auf Rohfaser spezialisierte Bakterien.
In diesen Darmabschnitten ist keine enzymatische Verdauung möglich, nur eine bakterielle Zersetzung, die jedoch bei Fehlbesiedlung im Darm zu gefürchteten Fehlgärungen und Koliken führen kann. Nimmt das Pferd im Rahmen einer radikalen Futterumstellung im Frühjahr viele Fruktane auf (ein normales Warmblut frisst pro Stunde 3 – 4 kg Gras), so gelangt ein Großteil dieser Kohlenhydrate unverdaut in den Dickdarm und stört massiv das physiologische Darmmilieu. Es kommt zur Übersäuerung im Dickdarm, zum Massensterben der guten Bakterien und zur Bildung von Fäulnisbakterien. Die Zerfallsprodukte der zugrunde gegangenen Bakterien (Endotoxine) kommen in den Blutkreislauf, ebenso wie schädliche Stoffwechselprodukte der unerwünschten Bakterien. Neben Darmproblemen (z. B. Kotwasser oder Koliken) können auch Muskelprobleme und die gefährliche Hufrehe entstehen. Hohe Eiweißkonzentrationen im frischen Gras tun ihr Übriges, denn der Anstieg des Harnstoffgehalts im Blut zieht eine zusätzliche Leber- und Nierenbelastung nach sich. Wichtig ist es daher, Pferde langsam an den Weidegang zu gewöhnen. Beginnend mit wenigen Minuten am Tag, dann die Weidezeit über mindestens 14 Tage, besser 3 – 4 Wochen langsam täglich erhöhen. Im Zuge eines Spaziergangs kann man sein Pferd wunderbar am Halfter grasen lassen. Tritt Durchfall auf, sollte die Steigerung unterbrochen werden. Vor dem Weidegang sollte das Pferd reichlich mit Heu gefüttert werden. Es empfiehlt sich, nach kalten Nächten empfindliche bzw. Hufrehe gefährdete Pferde, wenn überhaupt, erst am frühen Nachmittag auf die Weide zu lassen, und das auch nur für kurze Zeit. Abgefressenes, kurzes Gras hat einen besonders hohen Fruktangehalt.
Gestaltung eines artgerechten Anweideplans
Die tägliche Anweidezeit sollte pro Tag um 15 Minuten verlängert werden. Dabei muss das Wetter im Blick gehalten und die Gegebenheiten für Fruktanspitzen im frischen Grün gemieden werden. Bei vorbelasteten Pferden sollte man die Fresszeiten am Anfang kürzer wählen und erst beginnen, wenn das Gras eine Aufwuchshöhe von 25 cm erreicht hat. In der ersten Woche wird empfohlen, immer nachmittags anzuweiden, da die Temperaturen über den Tag ansteigen und somit der Fruktangehalt im Gras geringer wird. Ab der zweiten Woche dürfen die Tiere zusätzlich vormittags in Massen Gras fressen. Bei Stoffwechsel vorbelasteten Pferden sollte man sich für diesen Schritt einige Tage länger Zeit lassen. Eine Heufütterung am Morgen verhindert ein übermäßiges Schlingen auf der Weide.
Pferde mit Stoffwechselproblemen sollten länger und langsamer angeweidet und Hufrehe gefährdete Pferde erst am frühen Nachmittag auf die Weide gelassen werden.
Einsparung von Kraftfutter
Während der Anweidezeit und zum Start der Weidesaison empfiehlt es sich, das Kraftfutter anzupassen. Dieser Punkt wird kontrovers diskutiert, aber ich bin der Meinung, dass die Pferde ihre Portion erhalten sollten, denn eine Umstellung und ein Zuwenig an Mineralien und Vitalstoffen würde eine Leistungseinschränkung zur Folge haben. Nur weil ein Pferd auf der Weide steht, heißt das nicht, dass es keine Mineralien und Spurenelemente braucht. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele Wiesen bzw. das Gras im Vergleich zu früher nicht mehr den gleichen Gehalt an Mineralien und Vitalstoffen enthält. Meiner Ansicht nach dient die Weide nicht dazu, das Pferd komplett mit Futter abzudecken, denn dazu reichen die Weideflächen meist nicht aus. Aber Sozialkontakt und Bewegung sind gegeben, das ist ein wichtiger Ansatz.
Gute Kräuter und Futtermittel während des Anweidens
Kräuter und probiotische Zusätze können die Verträglichkeit des Anweidens verbessern und helfen, die Darmstabilität zu erhalten. Kräuter, um eiweißreiches Gras besser zu verdauen, werden bei Pferden empfohlen, die prinzipiell die Tendenz zeigen, Blähungen, Darmprobleme oder eine Hufrehe zu entwickeln, denn sie regen Stoffwechsel und Verdauung an und ermöglichen somit ein problemloses Anweiden.
Entwurmung
Sollte immer vor dem Anweiden erfolgen, da der Stoffwechsel durch eine chemische Entwurmung stark belastet wird. Eine natürliche
Entwurmung kann z. B. mit diversen Kräutern erfolgen (Bitterstoffe). Ich empfehle hier eine 7-Tage-Gabe der Kräuter gefolgt von 7 Tagen Pause, dann noch einmal 7 Tage Kräutergabe (viele Firmen arbeiten mit 5 Tagen). Bitterstoffe sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe (stellen aber keine eigene Gruppe dar), z. B. Löwenzahn, Wermut und Enzian. Enzian ist der bitterste Stoff, der in der Natur vorkommt. Bitterstoffe dienen als Schutz der Pflanze, damit diese nicht gefressen wird. In Wildkräutern sind Bitterstoffe noch vorhanden, bei vielen kultivierten Pflanzen wurde das Bittere weggezüchtet. Eigentlich schade, denn mittlerweile essen wir fast nur noch süß und kennen den Reiz des bitteren Geschmacks fast nicht mehr. Über Geschmacksrezeptoren werden die Verdauungssäfte und -enzyme angeregt. Auch auf den Schleimhäuten sitzen die Rezeptoren für „bitter“. Daher empfiehlt es sich, daran zu denken, in der eigenen Ernährung das Bittere nicht mit Honig oder Zucker zu kaschieren, denn auch wir brauchen Bitterstoffe in unserer Ernährung. Bittere Salate oder Oliven, welche die Leber fördern, reduzieren auch Gelüste auf Süßes. Bitterstoffe regen die Viszeralien, wie Leber und Galle, Milz und Pankreas (Bauchspeicheldrüse), an.
Helfer aus der Natur
Bitterstoffe haben sich bestens beim Anweiden bewährt. Die bitterwürzigen Kräuter unterstützen die Darmflora und helfen, energieund eiweißreiches Gras und Heu besser zu verdauen. Sie fördern die Sekretion der Verdauungssäfte und regen die Bauchspeicheldrüse an. Dadurch kann sich die Darmflora regenerieren und der Blinddarm wird entlastet.
Aber es gibt noch ein Problem: Endophyten. Das sind Pilze, die zwischen den Zellen der Gräser leben und dort Gifte produzieren. Sie sorgen für eine erhöhte Stressresistenz der Gräser gegen Trockenheit und schützen durch ihre Toxine das Gras vor Fressfeinden wie Insekten. Pferde stellen für Gräser ebenfalls Fressfeinde dar und reagieren nach dem Verzehr durch diese Gifte mit geschwollenen Beinen, Hufrehe oder einer atypischen Weidemyopathie. Daher sollten Pilze und deren Gifte bereits vorne im Darm gebunden werden, bevor sie Schaden anrichten können. Das lässt sich z. B. mit Zeolith und Klinoptilolith (aufgrund der hohen Absorbtionsfähigkeit) erreichen. Zeolith kann Gifte und andere Schadstoffe binden. Seine weiteren Inhaltsstoffe, wie Ringelblume und Galgant, wirken sich positiv auf die Schleimhäute des Darmes aus. Der natürliche Mineralstoff Kalzium beugt einer Übersäuerung des Organismus vor. Pferden, die Kräuter in getrockneter Form nicht gut akzeptieren, kann Löwenzahnsaft angeboten werden. Er enthält einen hohen Anteil an Bitterstoffen und regt damit in sanfter Weise Leber, Galle und Nieren an. Mit Brennesselsaft stabilisieren wir die Darmflora während der Futterumstellung. Es empfiehlt sich, beide Säfte im 3-Tage-Wechsel zu geben oder auch zusammen. Die meisten Pferde mögen Löwenzahn und Brennnessel als Säfte gerne.
Mischungen
Es gibt Mischungen diverser Firmen, die seit Jahren auf dem Markt sind und von den Pferden sehr gut angenommen werden. Auch flüssige Varianten von Löwenzahn und Brennnessel sind erhältlich. Wichtig ist, die Ration an Mineralfutter unverändert weiterzufüttern, wobei es sich anbietet, ein natürliches Mineralfutter zu verwenden. Dieses enthält Seealgen, Möhren, Pastinaken, Brennnessel, Sellerie, Hirtentäschel, Anis- und Fenchelsamen, Eichenrinde, Lauch, Hagebutte, Birkenrinde, Kokos, Schachtelhalm und Apfelpektin. Ebenso gibt es tolle Mischungen mit Blütenpollen (diese sollte man nur kurweise füttern, da eventuell Allergien auftreten könnten) wie Traubenkernmehl, Bierhefe und Spirulina. Alle natürlichen Ursprungs, sodass wir die Natürlichkeit unserer Pferde bewahren.
MARINA SAILER
Tierheilpraktikerin
Pferdetraining, Jungpferde-Ausbildung, artgerechte Pferdehaltung, Stresspunktmassage für Pferde und Hunde, Laboruntersuchungen, Ernährungsberatung